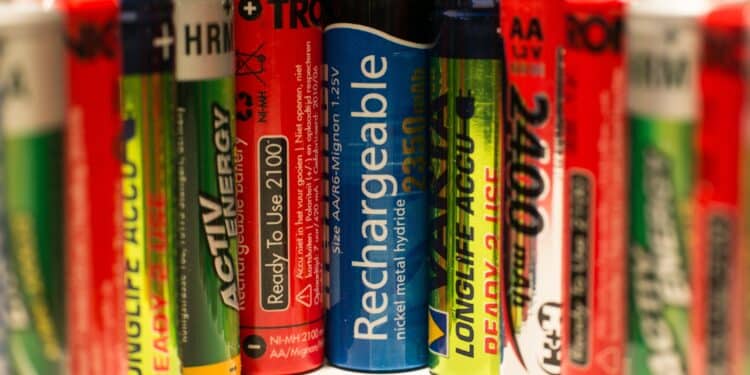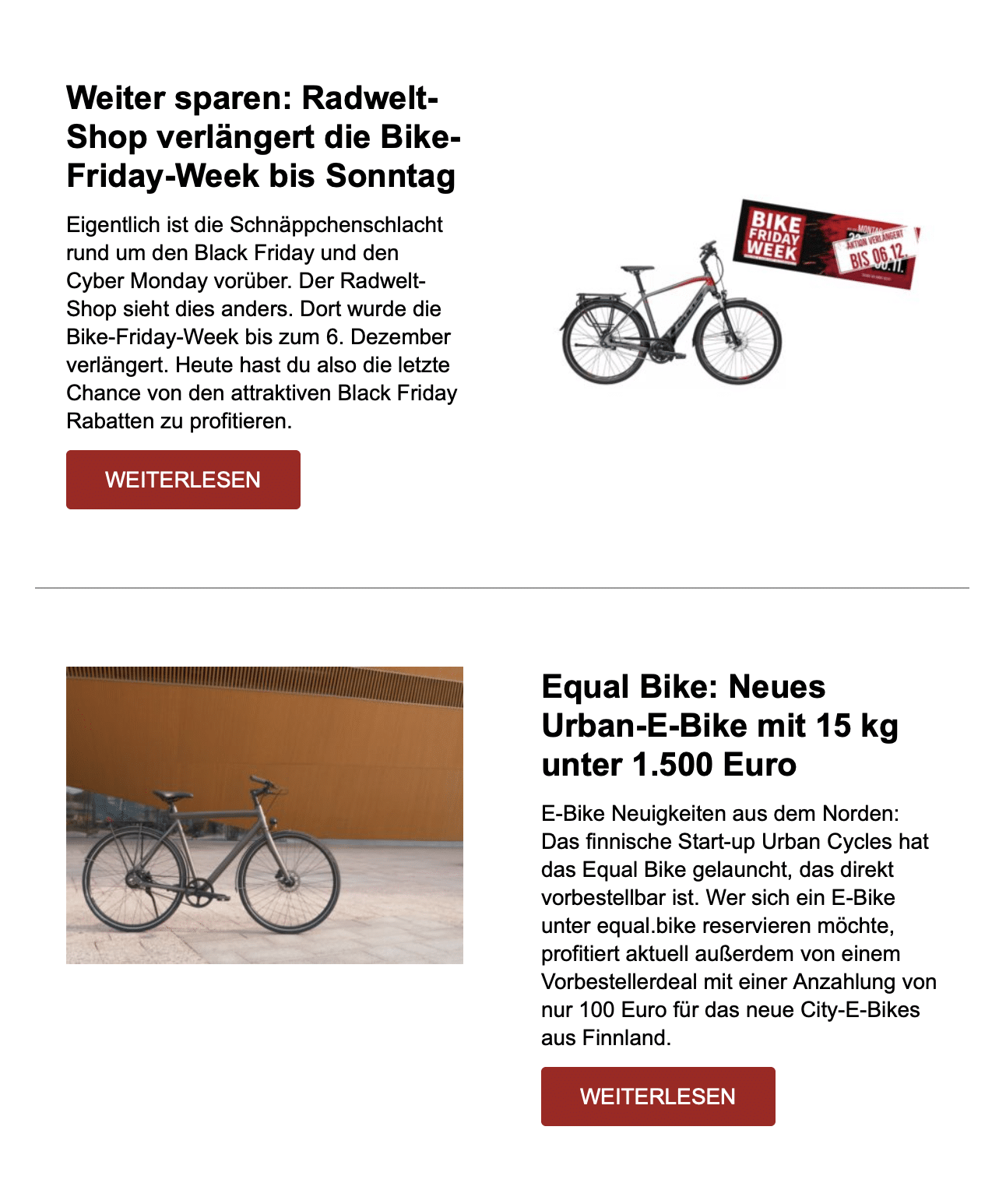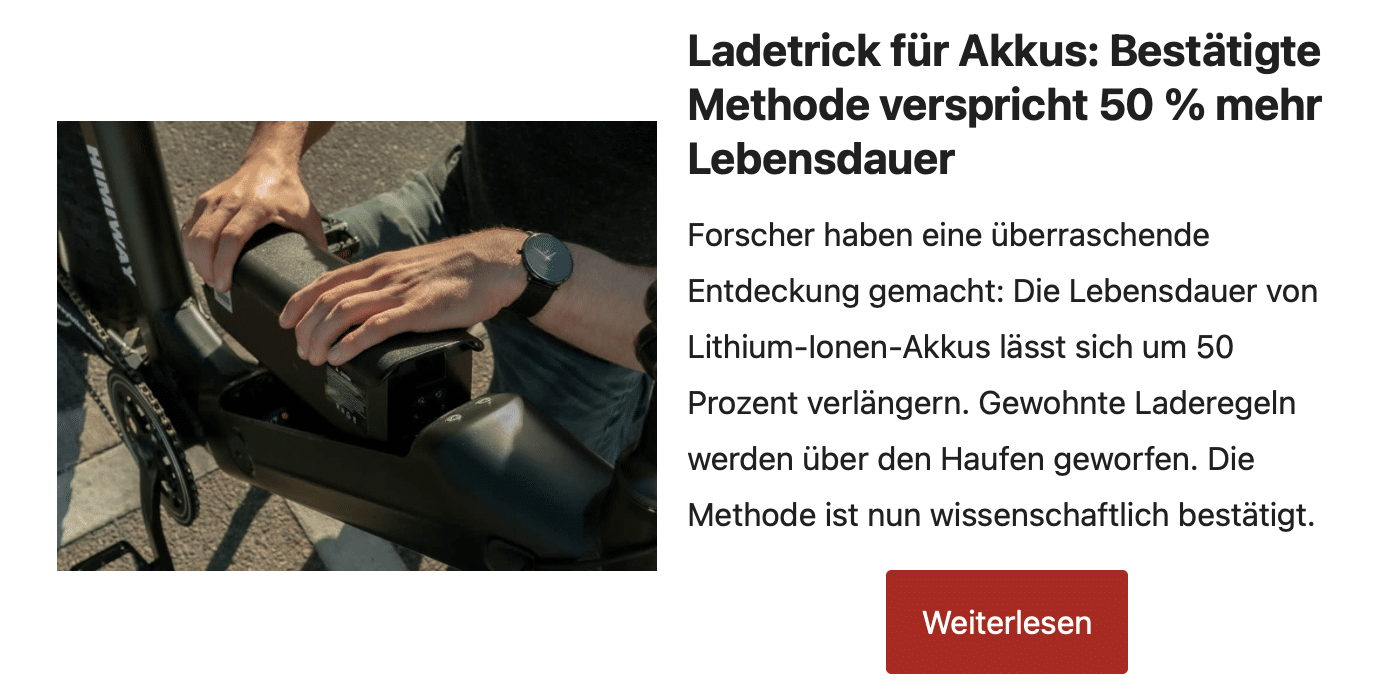Ein Team der TU München hat bei einem Mann mit Querschnittslähmung erstmals in Europa eine Hirn-Computer-Schnittstelle implantiert. Das Ziel besteht darin, Geräte wie Smartphones oder sogar Roboterarme allein mit Gedanken zu steuern.
Wie der Hirn-Chip Gedanken in Bewegung umsetzt
Bei dem Patienten wurde ein kleiner Chip mit 256 Elektroden in dem Bereich des Gehirns eingesetzt, der für geplante Bewegungen zuständig ist. Anstatt Muskelsignale an Arme oder Beine weiterzugeben, was bei einer Querschnittslähmung nicht mehr möglich ist, werden die Hirnsignale direkt aufgezeichnet, analysiert und in Steuerbefehle umgewandelt.
Anfangs steuert der Patient damit einen Cursor auf einem Bildschirm. Später soll er damit auch einen Roboterarm bewegen können, um beispielsweise zu trinken oder zu essen. „Anstatt von Menschen zu erwarten, dass sie sich anpassen und den Umgang mit Robotersystemen erlernen, liegt unser Schwerpunkt darauf, Systeme zu entwickeln, die menschliche Absichten erkennen“, sagt Teamleiterin Dr. Melissa Zavaglia.
Die Technik erinnert an Projekte wie Neuralink von Elon Musk, unterscheidet sich aber in wichtigen Punkten. Während Neuralink auch Schnittstellen für Kommunikation und allgemeine Gerätesteuerung entwickeln will, liegt der Fokus in München auf konkreter Alltagshilfe und medizinischer Anwendung. Außerdem handelt es sich hierbei um ein öffentlich gefördertes Forschungsprojekt und nicht um ein kommerzielles Produkt.
Großes Potenzial – aber noch weit von der Praxis entfernt
Auf dem freien Markt ist das System nicht zu haben, da es sich um ein Forschungsprojekt handelt. Zu Beginn geht es primär darum, besser zu verstehen, wie sich Gedanken in konkrete Steuerimpulse umwandeln lassen. Das könnte langfristig Menschen mit schweren Lähmungen helfen, im Alltag wieder selbstständiger zu werden. Genau das sagt auch der erste Patient: „Ich erhoffe mir, dass ich wieder selbständig essen und trinken kann und etwas weniger Hilfe im Alltag benötige.“
Auch ein Exoskelett, das sich per Gedankenkraft steuern lässt, ist theoretisch denkbar – etwa in Kombination mit Systemen wie dem Dnsys X1 (Test) – bisher als Consumer-Produkt vermarktet – oder dem XoMotion-Exoskelett, das auf eigenständige Bewegung ohne fremde Hilfe abzielt.
Bis zur Marktreife dürfte es aber noch mehrere Jahre dauern. Derzeit funktioniert die Technik nur unter Laborbedingungen, die Daten müssen individuell trainiert werden und die Kosten sind enorm hoch. Trotzdem zeigt die erste Implantation, in welche Richtung sich die Neurotechnologie in Europa entwickelt und dass Deutschland dabei ganz vorn mit dabei ist.