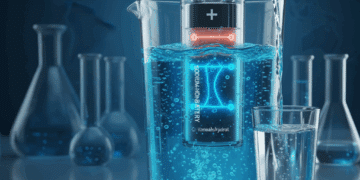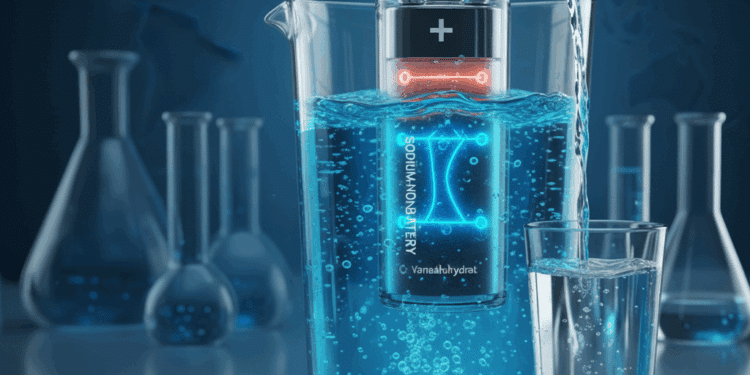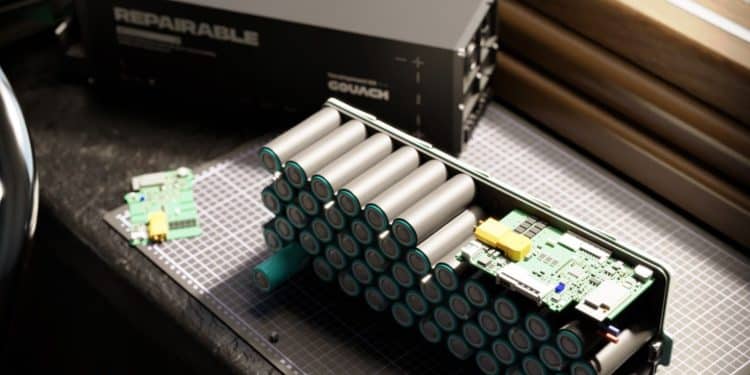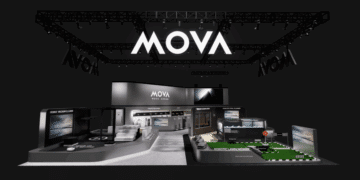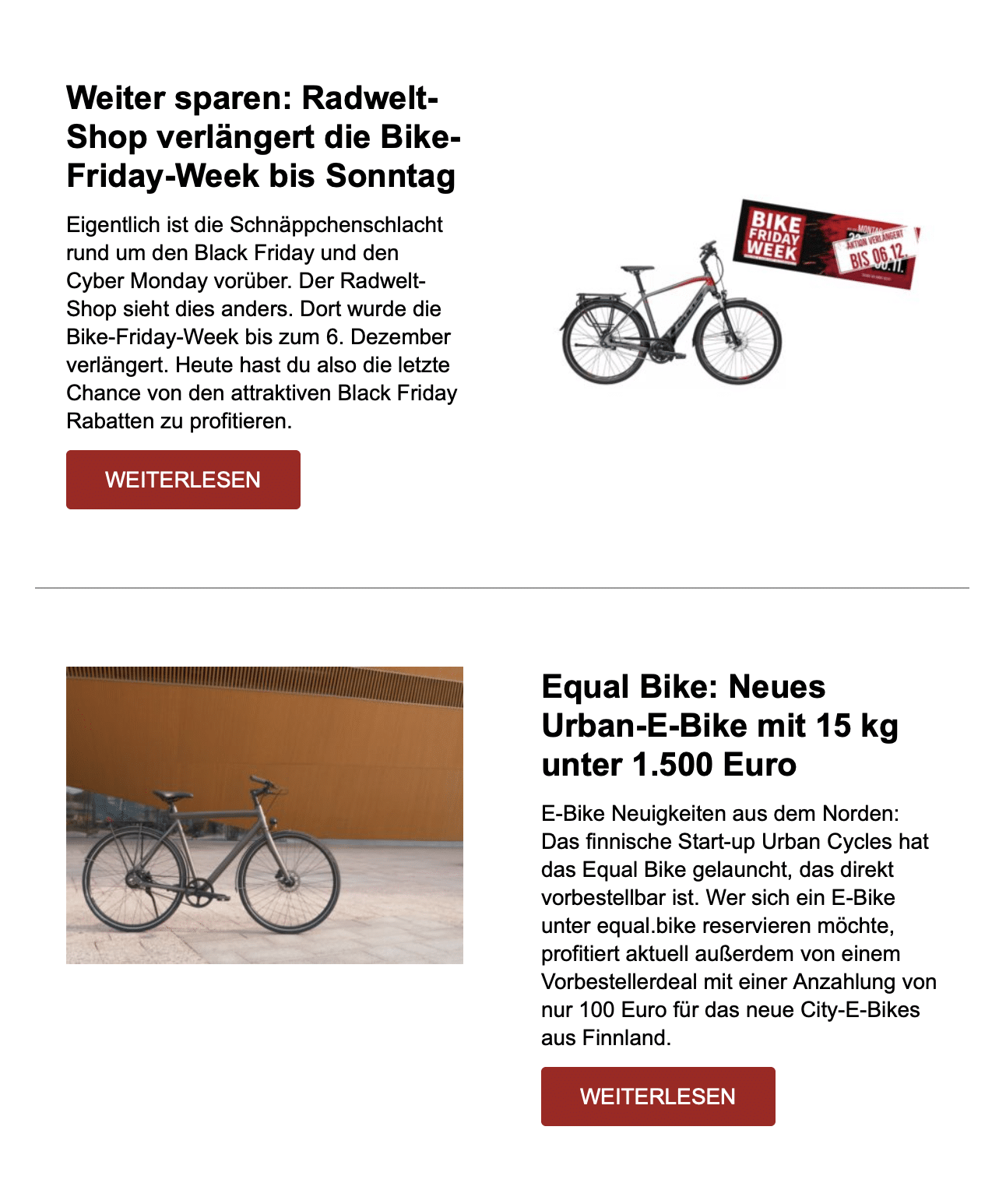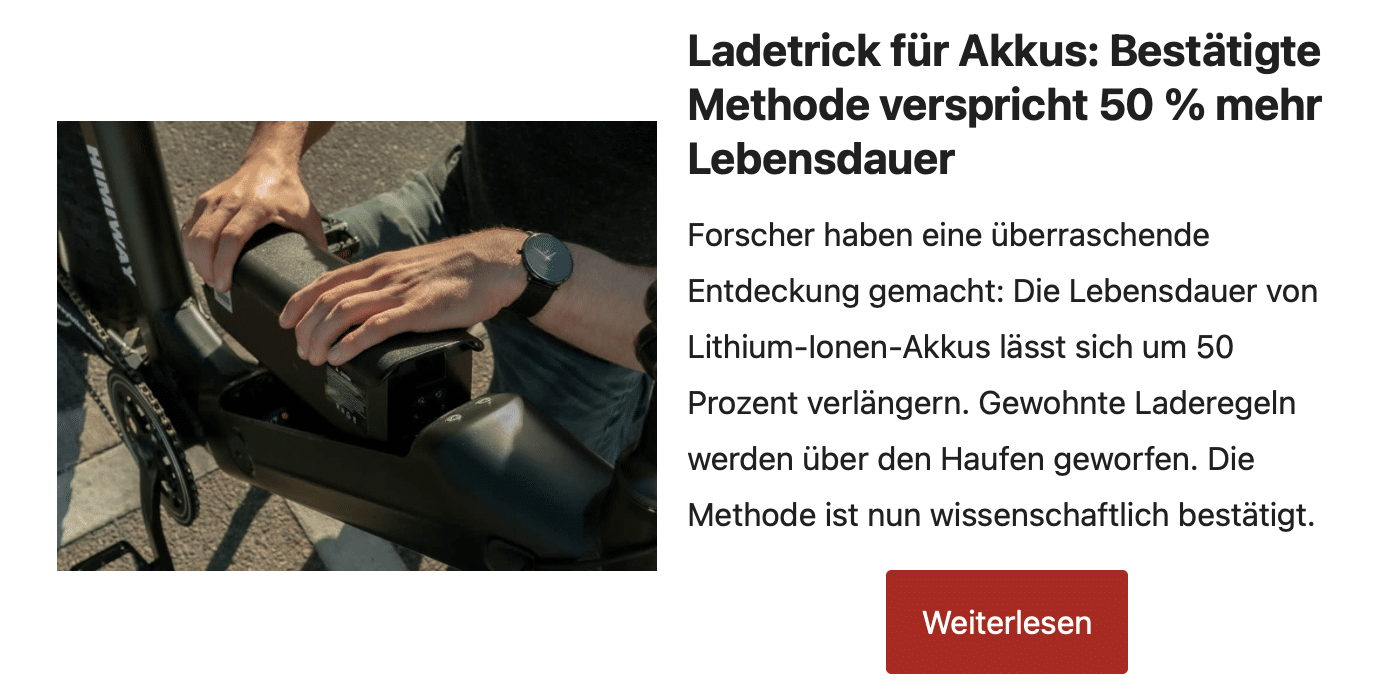Batterieforscher aus Südkorea versprechen mehr Leistung, höhere Sicherheit und eine längere Lebensdauer. Was jetzt schon im Labor funktioniert, könnte unsere Smartphones, E-Bikes und viele andere Geräte grundlegend verändern.
Silizium-Akkus: Forscher melden Durchbruch
Silizium macht Akkus zwar besonders leistungsfähig, bringt aber ein Problem mit sich: Beim Laden bläht sich das Material auf, beim Entladen schrumpft es wieder. Das sorgt für Risse und Hohlräume. Die Folge sind eine geringere Leistung, eine kürzere Laufzeit und im schlimmsten Fall sogar ein Komplettausfall.
Genau das soll ein neues System aus Südkorea verhindern, um Silizium-Akkus alltagstauglich zu machen. Es verbindet Elektrode und Elektrolyt fest miteinander durch eine chemische Reaktion zwischen einem speziellen Klebstoff auf der Elektrode und dem Gel im Elektrolyt.
Das klingt kompliziert, doch in der Praxis soll es sehr angenehme Folgen haben. Die neue Akku-Zelle erreichte in Labortests eine Energiedichte von 403,7 Wh/kg – fast doppelt so hoch wie aktuelle Tesla-Modelle (241 Wh/kg). E-Bikes könnten statt zum Beispiel 80 km plötzlich etwa 150 km weit fahren. Auch die Sicherheit würde steigen, da auf flüssige, entflammbare Elektrolyte einfach verzichtet werden kann. In Labortests blieb der Stromfluss selbst nach gezielten Beschädigungen stabil, ohne dass es zu Kurzschlüssen oder Leckagen kam.

Kein Akku ist perfekt: Was jetzt noch fehlt
Trotz aller Vorteile ist das neue System nicht ohne Einschränkungen. So ist die Herstellung noch komplexer als bei klassischen Lithium-Ionen-Akkus. Damit die chemische Verbindung funktioniert, müssen bestimmte Bedingungen exakt eingehalten werden. Das macht den Aufbau aufwendiger und dürfte auch die Produktionskosten erhöhen. Noch ist die Technik zudem nicht serienreif.
Ganz allein steht das Silizium-Akku-System mit seinem Potenzial nicht da. Parallel dazu arbeiten Forscher weltweit an ähnlichen Konzepten mit anderen Materialien. So hat ein Team aus China zuletzt einen Aluminium-Ionen-Akku vorgestellt, der bis zu 10.000 Ladezyklen überstehen soll und dabei weniger als ein Prozent seiner Kapazität verliert.
Ebenfalls aus China stammt die Idee einer Mini-Nuklearbatterie, die mit einem radioaktiven Nickel-Isotop betrieben wird. Sie soll 50 Jahre lang Energie liefern, ohne jemals aufgeladen werden zu müssen. In den USA wiederum arbeiten Forscher daran, Strahlung von Atommüll direkt in elektrische Energie umzuwandeln. Dieser Ansatz steckt zwar noch in den Kinderschuhen, doch er zeigt bereits jetzt vielversprechende Ansätze als Stromquelle für extreme Einsatzgebiete wie den Weltraum oder in der Reaktortechnik.